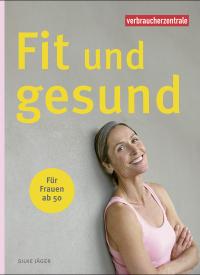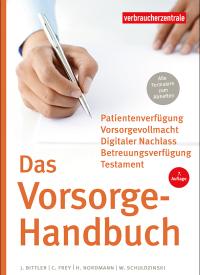Was können Algorithmen und wie nützen sie uns?
Algorithmen können einiges und manches davon besser als Ärztinnen und Ärzte. Das liegt daran, dass die eingesetzten Algorithmen häufig selbstlernende Systeme sind, die man mit einem riesigen Paket an Patient:innendaten füttern kann. Algorithmen lesen riesige Mengen an Patient:innendaten aus. Eine vergleichbare Menge an Daten könnte kein Mensch verarbeiten. Deshalb können Algorithmen Muster erkennen, die Menschen verborgen bleiben.
Für die Medizin bedeutet das: Ein Algorithmus kann Wahrscheinlichkeiten erkennen und berechnen, von denen eine Ärztin oder ein Arzt vielleicht nicht einmal wissen, dass es sie gibt.
Algorithmen retten Herzinfarkt-Patient:innen
Ein Beispiel: Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Je länger das Herz nach einem Infarkt ohne Sauerstoff bleibt, desto größer ist die Gefahr, zu sterben. Das bedeutet umgekehrt auch: Je früher man einen sich anbahnenden Infarkt erkennt, desto höher sind die Überlebenschancen.
Deshalb werden Risikopatient:innen in Krankenhäusern von Medizintechnik überwacht, die bei Kammerflimmern oder einem Infarkt im Anfangsstadium Alarm schlägt. Und trotzdem kann nicht jeder Infarkt verhindert werden. In den USA erleiden bis zu 400.000 Menschen jährlich einen Herzinfarkt, obwohl sie bereits in einem Krankenhaus sind.
In einem Krankenhaus nördlich von Detroit hat ein Algorithmus die Sterberate unter den Herzpatient:innen innerhalb von 4 Jahren auf ein Drittel reduziert. Die neue Software überwacht den Blutdruck, Puls, Temperatur sowie Herz- und Atemfrequenz. Daran ist an sich nichts neu. Das System betrachtet aber, anders als bisherige Technik, nicht nur die einzelnen Werte, sondern auch ihr Zusammenspiel.
Während früher der Alarm anschlug, wenn ein Wert signifikant aus der Reihe fiel, warnt das neue System Ärztinnen und Ärzte schon deutlich früher: Nämlich dann, wenn sich bei mehreren Werten gleichzeitig Veränderungen ergeben, auch wenn die Schwankungen nur geringfügig sind. Eine computerbasierte Auswertung von 20.000 Patient:innendaten hatte im Vorfeld ergeben, dass schon einige Stunden vor dem lebensbedrohlichen Ereignis solche Muster in den Gesundheitswerten erkennbar sind.
Auch in Deutschland und den Niederlanden wird an der auf Algorithmen basierten Prävention von Herzerkrankungen geforscht. Ziel: Eine Smartphone-App, die Herzrhythmusstörungen erkennen kann. Dazu werden die Blutgefäße regelmäßig mit dem Licht des eigenen Smartphones durchleuchtet.
Von Diagnose bis Prognose – das leisten Algorithmen in der Medizin
Digitale Algorithmen sind in unserem Medizinsystem längst angekommen. Sie lesen riesige Mengen an Bilddaten aus und können so Krebs- und sogar Corona-Infektionen erkennen. Bei schwer erkrankten Patient:innen gibt es Modelle, die aufgrund der vorhandenen Gesundheitsdaten berechnen können, wie lange sie voraussichtlich noch leben werden.
Auch in der Therapie kommen Algorithmen zum Einsatz. Sie können zum Beispiel bei Menschen mit Leberkrebs dazu beitragen, dass die Operation effektiver und sicherer wird. Auf der Basis eines 3-D-Modells berechnen sie im Vorfeld optimale Schnitte und besonders kritische Abschnitte.
Oder sie optimieren in Implantaten das Hörerlebnis für Menschen mit Hörschäden. Für Menschen mit Diabetes gibt es mittlerweile eine Smartphone-App, die als persönlicher Assistent fungiert. Ein kleiner Sensor unter der Haut sendet alle 5 Minuten Blutzuckerwerte an die App. Sobald der Wert den individuellen Höchst- oder Tiefstwert unterschreitet, gibt die App ein Alarmsignal.
Mehr darüber, wo Algorithmen bereits eine Rolle spielen, erfahren Sie in der Bertelsmann-Studie Algorithmen in der Gesundheitsversorgung.